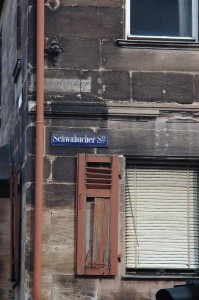Der plötzliche Tod von Robert Schopflocher hat auch mich sehr traurig gemacht. Von Beginn an begleitete Herr Schopflocher unsere Arbeit mit großem Interesse und Wohlwollen. Vieles davon finden Sie auf diesen Seiten. Immer wieder hat er uns an seinen Fürth-Erinnerungen teilhaben lassen und sich nach Denkmalorten in seiner Heimatstadt erkundigt. Dieser wunderbare Austausch wird mir fehlen. Unten der sehr schöne Nachruf aus den Fürther Nachrichten von Bernd Noack.
Dialog mit den Geistern der Vergangenheit
Der aus Fürth stammende Schriftsteller Robert Schopflocher ist mit 92 Jahren in Buenos Aires gestorben
VON BERND NOACK
Der 1923 in Fürth geborene jüdische Schriftsteller Robert Schopflocher, der sich in seiner Exil-Heimat Argentinien Roberto nannte, ist am vergangenen Samstag in Buenos Aires gestorben.
Wer das Glück hatte, Robert Schopflocher kennenzulernen, der traf auf einen distinguierten älteren und altersweisen Herrn, der zuhören und erzählen konnte, der neugierig war noch immer, obwohl er doch in mehr als neun Jahrzehnten so viel erfahren und durchgestanden hatte. Schopflochers Augen leuchteten, wenn er in seine Erinnerungen abtauchte und aus dem ganzen Wissens- und Daseins-Schatz die Zeiten hervorholte, in denen er den Segen des Lebens genießen, aber auch die Abgründe des Schicksals ertragen musste. Der Segen, das war die Kindheit in seiner Geburtsstadt Fürth. Hier kam er am 14. April 1923 zur Welt, als Sohn einer großbürgerlichen jüdischen Familie. Im stattlichen Gebäude an der Königswarterstraße spielte das Kind und wuchs heran: Als Schopflocher bei einem seiner zahlreichen Fürth-Besuche nach dem Krieg nochmal in seine alte Wohnung kam, fand er im Holz eines Türstocks die Kerben wieder, die eingeritzt wurden um zu kontrollieren, wie schnell das Kind damals größer wurde. Flucht vor den Nazis Solche Details, anrührend viele und – wie man sehen sollte – nicht wenige tragisch, waren es, die Robert Schopflocher seit der Flucht vor den Nazis im Jahr 1937 mit sich und im Herzen trug. Schopflochers Gedanken an das alte Fürth waren ungemein sinnlich: er beschrieb Gerüche und Geräusche, er hörte noch die Töne einer quietschenden Straßenbahn und sah vor sich die bunten Lichter der Kirchweih, als er schon lange in Argentinien lebte, wohin sich seine Familie seinerzeit in Sicherheit gebracht hatte. Diese Sicherheit war für Schopflocher nie unproblematisch. Und hier sind wir bei den Abgründen: Der „Verkettung nicht voraussehbarer Umstände ist es zuzuschreiben, dass ich nicht in der Gaskammer oder im Krematorium endete wie mehr als einer meiner früheren Schulkameraden und Schulfreunde,“ schrieb er in seinen Erinnerungen „Weit von hier“. Schmerzhaft unsentimentale, knappe, lapidare Gedanken waren das über eine abenteuerliche Reise durch die Welt, an deren Beginn der Zufall stand. Solche Sätze, die in die Idyllen wie Hiebe fuhren, blieben dem Leser im Hinterkopf, und man spürte, wie brüchig eine Existenz ist, von wieviel ungeahnten Ereignissen sie beeinflusst wird, wieviel Verluste sie begleiten. Robert Schopflocher, der „Davongekommene“ hat diese „Umstände“ aber auch als Auftrag begriffen: Er ruhte sich nicht aus auf seinem Glück, sondern mischte sich denkend, schreibend und handelnd ein. Also fragte er – und bezog das eben nicht allein auf seine jüdische Herkunft –, warum eine Minderheit denn kulturelle Errungenschaften, Tradition und Geschichte über Bord werfen sollte, „gewissermaßen als Preis, um von der Umwelt akzeptiert zu werden“? Schopflocher selber hat konsequent an seiner Identität festgehalten, auch und vor allem in der Fremde, die ihm nach und nach zur Heimat wurde: die Vertreibung konnte ihm die Reminis-zenzen, den Stolz, den Schmerz und die Hoffnung nicht austreiben. Soviel erlittene Erniedrigung, Ausgrenzung und Abschiede aber trug er mit sich herum, immer war da das „nachhallende Grundgeräusch, das von der Shoah ausgeht“, und dennoch war er fähig zu Sätzen wie diesem: „Verwundert stelle ich fest, dass das Kindheitsland, aus dem ich verstoßen wurde, in den tiefen Schichten meines Seins weiter lebt und wirkt, trotz der unfassbaren Verbrechen, die in ihm stattgefunden haben. Das Land und seine Sprache.“ Zu dieser, seiner Mutter- und Vater-Sprache (und also zum Schreiben) zurück fand Schopflocher spät und erst dann wirklich, als er sie nicht mehr rund um sich hören konnte. In Argentinien, wo er im Brotberuf als Verwalter landwirtschaftlicher Güter und als Kaufmann arbeitete, ent-stand erste Prosa in spanischer Sprache, dann begann er auf Deutsch zu schreiben. Seine argentinischen Erzählungen erschienen bald übersetzt im renommierten Suhrkamp Verlag, sein erster deutsch verfasster Roman „Wie Reb Froike die Welt rettete“, in dem das vergessene und zerstörte jüdische Schtetl lebendig wurde, war ein großer Erfolg bei Kritik und Lesern. Es folgten weitere Romane, oft genug Brückenschläge zwischen der alten verlorenen Welt und der rettenden neuen Heimat, Gedichte, feuilletonistische Ausflüge in die Vergangenheit. 2008 ehrte ihn die Stadt Fürth mit dem Jakob-Wassermann-Literaturpreis. Sein vor kurzem erschienener letzter Roman „Das Komplott zu Lima“ erzählt sprachgewaltig von dem gefährlichen Leben der Juden im Südamerika des 17. Jahrhunderts. Was man vermisst Eine schlichte Karte von Robert Schopflocher, datiert auf den 8. Dezember 2015, erreichte mich erst dieser Tage als verspäteter Neujahrsgruß. Die Schrift schon zittrig, drücken die Wünsche zu einer „glücklicheren Epoche 2016“ Verbundenheit aus, auf die sich verlassen konnte, wer den Schriftsteller kannte. Und einer der letzten Texte aus der Feder Robert Schopflochers dürfte ein Beitrag zu einer Serie im Lokalteil der Fürther Nachrichten sein, in der es um Dinge, Orte und Menschen geht, die man vermisst. Darin heißt es – und es klingt wie ein Vermächtnis: „Man sollte sehr genau aufpassen, welche Geister man durch die Pforten der Erinnerung schlüpfen lässt, und welchen man die Gnade der Vermisstmeldung angedeihen lassen soll. Eine Selektion, bei der wir mit dem guten Willen der Nachgeborenen rechnen dürfen, deren ausgestreckte Freundeshand wir dankbar ergreifen.“



 Sehr einladend zeigt sie sich ausgerechnet bei ihrem „Entrée“ ja nicht gerade, die Fürther Südstadt, wenn man von der Innenstadt aus der Bahnunterführung in die Schwabacher Straße kommend nach links schaut. Dort steht das Haus Nummer 53. Mit ihm begann die Stadtentwicklung südlich der Bahnlinie – und damit auch die Geschichte der Südstadt. „Pechhütt´n“ nennen die Einheimischen dieses Anwesen oder „Weber´s Haus“. In der heutigen Folge aus der Reihe „Häuser erzählen Geschichten“ geht es um diesen freistehenden Eckbau, der 1831 von Maurermeister Meyer und Zimmermeister Georg Herrlein als Ausflugsgaststätte errichtet wurde.
Sehr einladend zeigt sie sich ausgerechnet bei ihrem „Entrée“ ja nicht gerade, die Fürther Südstadt, wenn man von der Innenstadt aus der Bahnunterführung in die Schwabacher Straße kommend nach links schaut. Dort steht das Haus Nummer 53. Mit ihm begann die Stadtentwicklung südlich der Bahnlinie – und damit auch die Geschichte der Südstadt. „Pechhütt´n“ nennen die Einheimischen dieses Anwesen oder „Weber´s Haus“. In der heutigen Folge aus der Reihe „Häuser erzählen Geschichten“ geht es um diesen freistehenden Eckbau, der 1831 von Maurermeister Meyer und Zimmermeister Georg Herrlein als Ausflugsgaststätte errichtet wurde. Danach wechselten die Eigentümer recht oft. Vielleicht erinnern sich manche Fürther noch an den letzten Bewohner, den Zahnarzt Dr. Herbert Fichtner, der dort bis in die 1980er Jahre auch seine Praxis betrieb.
Danach wechselten die Eigentümer recht oft. Vielleicht erinnern sich manche Fürther noch an den letzten Bewohner, den Zahnarzt Dr. Herbert Fichtner, der dort bis in die 1980er Jahre auch seine Praxis betrieb.